Mein Platz in der Welt
Gestern Abend in der Pilgerherberge komme ich mit P. aus Zürich ins Gespräch. P. ist schätzungsweise um die 60 Jahre alt, hat einst Philosophie studiert und danach eine Vielzahl an Jobs gemacht, allesamt keinen in seiner Profession. Nichts hat er wirklich lange getan. Eine bunte Mischung unterschiedlichster Tätigkeiten, scheinbar ohne Zusammenhang und Richtung. In die Schweizer Rente hat er nur das Minimum jährlich eingezahlt. Es wird später kaum zum Lebensunterhalt reichen, zumindest nicht hier. Die letzten 10 Jahre hat er sich offenbar hauptsächlich mit Lesen beschäftigt. Jetzt wolle er erstmal den Jakobsweg laufen. „Und danach sehe ich, wie es weitergeht.“, sagt er.
Manche würden P. einen Lebenskünstler nennen. Andere wahrscheinlich eher orientierungslos. Man fragt ihn öfter kritisch, welchen Beitrag er denn zur Gesellschaft leiste, welchen Platz er „endlich“ einnehmen will? Vielleicht denken sie auch, in seinem Alter ist es eh vorbei.
Wieso erzähle ich das?
Auch ich habe vor gut 7 Jahren mein Leben radikal geändert, verfolge Wege, die nicht jeder versteht, beschäftige mich mit Themen, die vielen wahrscheinlich zu abstrus, zu spirituell oder esoterisch sind. Nichts Handfestes, in mancherlei Augen, weil ich einiges mache, nicht lange genug, dass es zählen würde. Weil ich nicht DEN Job habe, den ich 40 Stunden in der Woche ausübe. Weil ich ein Potpourri an Tätigkeiten habe.
Menschen, wie P. und mir, begegnen viele, wenig schmeichelhafte Bemerkungen, Beurteilungen und Aussagen zu unserem Lebensstil. Vielleicht weil es nicht verstanden wird, dass auch solche Lebensweisen funktionieren. Vielleicht weil wir Urängste antriggern, die nach (mehr) Sicherheit verlangen. Vielleicht weil es neidisch macht. Und vielleicht weil es an die eigene Verantwortung appelliert, für das eigene Glück zuständig zu sein.
Natürlich gibt es auch die anderen Meinungen, die es mutig finden, die es bewundern und die ebenfalls andere Wege beschreiten.
Doch die Mehrzahl ist das nicht.
Und es lässt sich einfach sagen „Hör nicht auf die anderen. Du musst doch zufrieden sein mit deinem Leben. Du lebst dein Leben ja für dich und nicht für die Gesellschaft.“ Usw.
Nur so leicht lässt sich das nicht fühlen. Es verunsichert. Es verletzt. Es beschämt. Es macht traurig. Es macht wütend – ja, auch das. Und es frustriert mich, dass es in der Gesellschaft so enge Raster gibt für „wertvolle Beiträge“, für einen anerkannten Platz. Dass ich überhaupt was leisten muss, bevor ich als Teil der Gesellschaft anerkannt werde. Das bestürzt mich.
Und all diese Gefühle kommen insbesondere deshalb in mir hoch, weil ein Teil in mir versteht, dass die meisten so auf P. und mich reagieren. Vor meinem Lebensumbruch dachte ich ähnlich, empfand ich in vielerlei Hinsicht ebenso. Und mir ist klar wieso: ich bin so geprägt, die Angst, wie geht es weiter, wie soll das funktionieren, aus der Herde auszuscheren, alleine dazustehen, begleitet mich auch heute noch – weniger werdend, aber sie ist noch da. Und früher spürte ich sehr tief die Sehnsucht nach „meinem“ Weg. Ich merkte, dass ich falsch unterwegs war. Die äußeren Werte – insbes. in Unternehmen, in der Wirtschaftswelt, aber auch häufig im allgemeinen Gesellschaftstenor – hatten nichts mit meinem inneren Wertesystem gemein. Das fiel mir schon im Studium auf. Ich hatte völlig andere Ansätze. Und der Widerspruch dessen, was im Außen gelebt wurde, was zählte, hat mich in dieser Zeit beinahe zerrissen. Alle, die mir damals begegneten, die ihre Werte lebten – so ungewöhnlich oder gar unmöglich es von außen auch aussehen mochte – faszinierten mich einerseits, andererseits lehnte ich es auch ab. Sie haben mich zutiefst verunsichert und beschämt. Ja, auch beschämt, waren sie doch Mahnungen an mich, endlich für mein eigenes Leben Verantwortung zu übernehmen.
Und so bin ich es heute für andere: eine Mahnung, dass das „Müssen“, „Nicht-Können“ und das „keine Wahl zu haben“ nur eine Schutzbehauptung an sie selbst gerichtet ist. Der Deckmantel darüber, dass sie eine Wahl haben und sich für dieses Leben entschieden haben – wenn auch unbewusst – weil das Bedürfnis nach Sicherheit zum Beispiel über allem steht.
Wer den Lebensstil von P. und mir als Möglichkeit zuließe, müßte sich automatisch fragen, ob der eigene überhaupt passt oder einer Korrektur bedarf. Und das würde bedeuten, die Komfortzone und damit die Sicherheit des Bekannten zu verlassen.
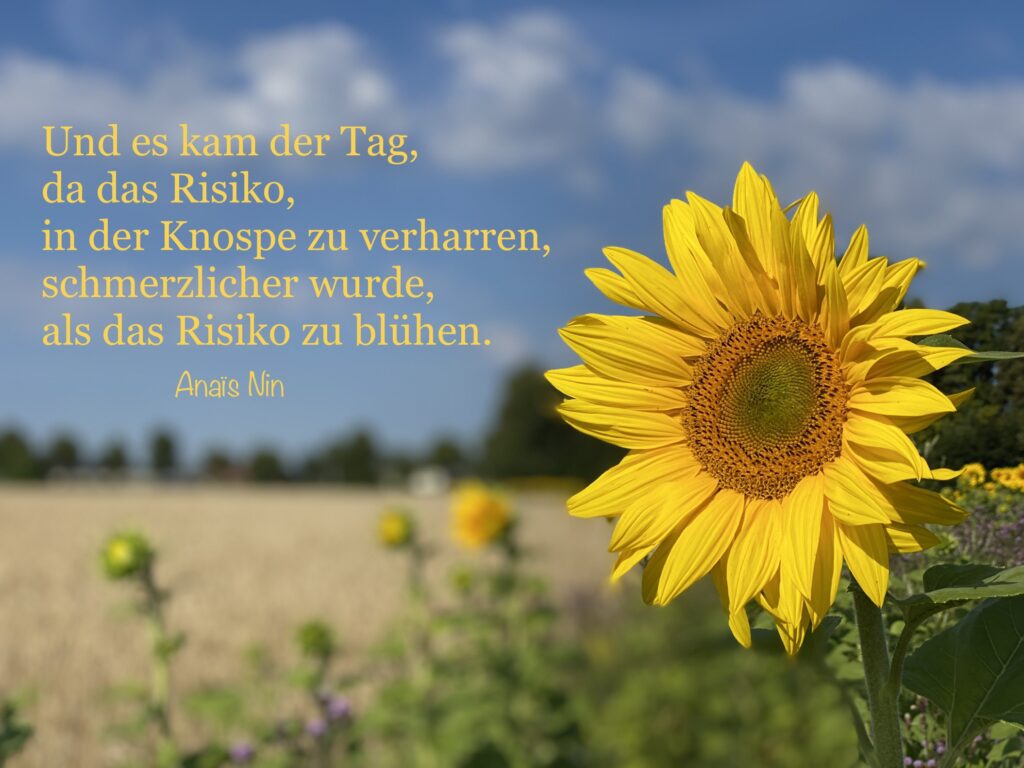
Wäre es leicht seinen eigenen Weg zu gehen, spielerisch tänzelnd und ohne Hindernisse, bräuchte es keinen Mut, die Komfortzone zu verlassen. Doch irgendwann kommt der Punkt – zumindest bei manchen – wo das Verharren im Sicheren mehr Angst macht, als der Ausbruch.
Das war der Zeitpunkt, an dem ich wegemutig wurde.




